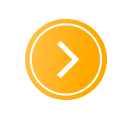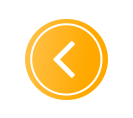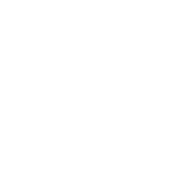Familie Conring
Das Conringsche Haus wurde zwischen 1804 und 1806 als klassizistisches Wohnpalais für die Juristenfamilie Conring errichtet. Zu dieser Familie gehörte auch der ehemalige Verwaltungsjurist und Ministerialbeamte Hermann Conring (*1894, †1989), der den Wiederaufbau nach dem Krieg vorantrieb. Er erhielt zu seinem 70. Geburtstag sogar das Große Bundesverdienstkreuz und wurde vom Leiter des Auricher Staatsarchiv im Jahr 1995 als „der bedeutendste Ostfriese im 20. Jahrhundert“ 2 bezeichnet. In neuerer Forschung zu seinem Leben wird besonders seine Zeit als Landrat im Nationalsozialismus deutlich kritischer gesehen – weshalb man ihn nicht mehr als „den bedeutendsten Ostfriesen im 20. Jahrhundert“ bezeichnen sollte 3 . Hermann Conring war während des Nationalsozialismus in verschiedenen Funktionen aktiv und spielte eine bedeutende Rolle in der NS-Verwaltung. Ab 1933 war er Landrat in Leer, wo er sich durch seine antikommunistische Haltung und seine Nähe zu NS-Ministerpräsident Carl Röver halten konnte. Conring unterstützte die NS-Verfolgung, unterzeichnete Haftbefehle gegen Oppositionelle und setzte sich für die Schutzhaft von sogenannten „feindlichen Elementen“, insbesondere Kommunisten, ein. Er war auch an der Absetzung des Leeraner Bürgermeisters Erich vom Bruch beteiligt, der daraufhin Suizid beging. Im Jahr 1937 trat Conring der NSDAP bei und übernahm in den darauffolgenden Jahren verschiedene Funktionen, unter anderem als Oberkriegsverwaltungsrat in Polen und Belgien sowie als Beauftragter für die Provinz Groningen. Trotz seiner eigenen Aussagen nach dem Krieg, dass er für die Nazis „wider seinen Willen“ tätig war, war er aktiv in der Nazifizierung der niederländischen Behörden und der Deportation von Juden beteiligt. In Groningen wirkte er in der Verwaltung und zeigte wenig Mitgefühl für die jüdische Bevölkerung, wobei er die Deportation vorantrieb und antisemitische Aussagen machte. Nach dem Krieg wurde Conring in einem britischen Internierungslager festgehalten, aber 1947 entlassen. Er versuchte sich vor Gericht als wenig involviert darzustellen, wurde aber als „nominaler Nazi-Unterstützer“ eingestuft. In den darauffolgenden Jahren setzte er seine Karriere fort, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Er wurde Generalsekretär des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Ostfriesland und arbeitete später im Niedersächsischen Landtag und im Bundestag. Trotz wiederholter Ermittlungen wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus und des Raubs von Kunstwerken kam es zu keiner Verurteilung. 1965 gab er das Große Bundesverdienstkreuz zurück, nachdem die Niederlande ihre Enttäuschung über die Verleihung des Ordens ausgedrückt hatte.