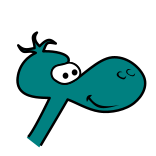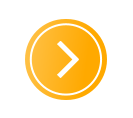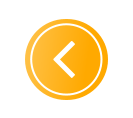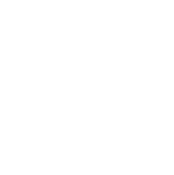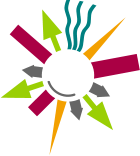Fachwerkarchitektur
Entlang der Straße „Dorfring“ stehen mehrere sehenswerte Fachwerkhäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit wurden sie umgebaut und haben daher ihr ursprüngliches Aussehen verloren. So ein Fachwerkhaus entsteht auch heute noch in vielen kleinen Einzelschritten und ist zu einem großen Teil Maßarbeit. Bis in die Neuzeit standen dafür jedoch keine Maschinen zur Verfügung. Man konnte damals nicht einfach im Holzhandel fertig zugesägtes Holz für den Hausbau kaufen. Stattdessen musste der Baumeister sein Holz selbst beschaffen. Die meisten Wälder waren in städtischer oder adeliger Hand. Nachdem er die Erlaubnis eingeholt hatte, durfte er in den Wintermonaten die benötigten Stämme für den Hausbau schlagen. Die Bäume wurden per Hand mit einer Axt oder Bügelsäge gefällt und bis zum Frühjahr gelagert. Danach mussten die Stämme zugerichtet werden, denn es sollten ja eckige Balken entstehen. Da es noch keine elektrischen Maschinen gab, nutzte man hierfür große Äxte und Handsägen. Anschließend wurden die zugesägten Stämme zur Baustelle in die Stadt transportiert, nachbearbeitet und in Position gebracht. Alles natürlich in Handarbeit oder mithilfe eines Ochsen- oder Pferdekarrens. Aus den Stämmen wurde eine vergleichsweise einfache Holzkonstruktion errichtet. Anschließend wurden die Bereiche zwischen den Balken, man spricht von Gefachen, verschlossen. Der Schritt des Schließens der Gefache wird als Ausfachung bezeichnet. Es können verschiedene Materialien zum Einsatz kamen beispielsweise: Astgeflecht, Lehmziegel oder Bruchsteine (unbehauene Steine aus dem Steinbruch). Anschließend wurde das Gefach mit Lehm verputzt. Gerade in neueren Fachwerkbauten (ab dem 19. Jahrhundert) werden die Gefache oft auch mit Ziegelsteinen vermauert, was deutlich einfacher und haltbarer ist.
Im Jahr 1744 wurde dieses Gefach am Hof
Bührmann (Station 7) mit Lehm geschlossen
bzw. verputzt.
Jahrhundertelang wurde Holz nicht nur zum
Bau von Häusern genutzt, sondern vor allem
auch als Brennmaterial. Gerade in Kriegs- und
Krisenzeiten war daher Holz oft Mangelware.
Auch wenn die Wälder im Besitz von
Landesherrn, Adeligen oder wohlhabenden
Bauern waren, kam es immer wieder zum
Holzraub. Durch Raub war der illegale
Holzeinschlag so groß, dass quasi ganze Wälder
verschwanden. Das Dötlinger Strafregister von
1773 listete Strafzahlungen für den Holzraub
aus dem Dötlinger Holz folgende Strafen auf:
für eine Fuhre Holz 18 Groschen, für die
Entwendung eines alten „Stümels“ 18 Groschen
und für das Entfernen von Buschwerk 12
Groschen.