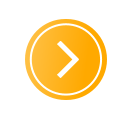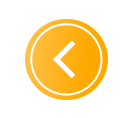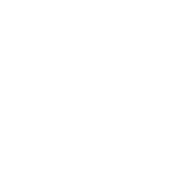Boltentorbrücke
Emden blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Mit der Reformation um 1520 kam es zu einer fast 200-jährigen Blüte der Stadt, wodurch der Hafen zeitweise zu einem der bedeutendsten in Europa wurde. Emden und Ostfriesland waren mit dem Tod des letzten Fürsten von Ostfriesland, Carl Edzard (*1716, †1744) aus dem Hause Cirksena, an Preußen gefallen. So besserte sich die wirtschaftliche Lage Emdens deutlich und es kam zu einem Aufblühen der Wirtschaft. Nach den Wirren der Französischen Revolution und den Schrecken der Napoleonischen Kriege fiel Emden laut den Beschlüssen des Wiener Kongresses im Jahr 1815 an das Königreich Hannover. Dies führte zu einem wirtschaftlichen Abschwung, zeitgleich verschlickte der Hafen und konnte schlechter angefahren werden. Zu dieser Zeit litt die Landwirtschaft in Ostfriesland unter anderem unter der Agrarkrise von 1846/1847, die schlussendlich zur Revolution von 1848/1849 führte. Vor allem die Kartoffelfäule zerstörte die Ernte. Es kam zur Verknappung und damit zu einem Einbruch des Hafengeschäfts bzw. dem Export landwirtschaftlicher Produkte. Mit dem Ende der Hannoverschen Zeit 1866, als Emden und das Hinterland wieder an Preußen fielen, besserte sich die wirtschaftliche Lage. Damals wurde die „Rückkehr“ nach Preußen voller Euphorie aufgenommen. Schon bald wurde der Hafen umfassend saniert, ausgebaggert und erweitert. Unter dem damaligen Bürgermeister Leo Fürbringer (*1843, †1923, 1875 wurde er zum Bürgermeister, ab 1877 Oberbürgermeister) entwickelte sich Emden zu einer modernen Hafen- und Industriestadt – noch heute spricht man von der „Ära Fürbringer“. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde diese wirtschaftliche Blütezeit jäh beendet. Eine zweite, deutlich kürzere wirtschaftliche Blütezeit wird in der Emder Stadtgeschichte oftmals übersehen: die Zeit zwischen etwa 1923 und 1929. Im Spätherbst 1923 wurde die Zeit der Hyperinflation durch die Einführung der Rentenmark überwunden und die Wirtschaft erholte sich wieder. Schon bald stiegen die Exportzahlen des Hafens, was zu einem Zuzug neuer Hafenarbeiter aus dem ländlichen Ostfriesland führte. Angesichts der Erfahrungen aus der gründerzeitlichen Wohnungsnot, entwickelte sich in Emden, wie in ganz Deutschland, die Idee des sozialen Wohnungsbaus. Dies führte zu einer regen Bautätigkeit. Es entstanden zahlreiche neue Wohnquartiere rund um die damalige Stadt, wodurch Emden deutlich über seine mittelalterlichen Mauern hinauswuchs. Die Architektur dieser Zeit brach mit den Ideen des Historismus, welche durch die mittelalterliche und neuzeitliche Architektur geprägt war. Die Architekten der frühen 1920er Jahre suchten nach einer „nüchterneren Formensprache“, vor allem jedoch war der Wunsch nach sozialer Bauweise groß. Die Architekten dieser Zeit nutzten „neue“ Baustoffe wie Glas, Beton und Stahl, gepaart mit innovativen Konzepten und Ideen der Stadtentwicklung. Man wollte weg von den gründerzeitlichen Mietskasernen des 19. Jahrhunderts, die eng, dunkel und abweisend waren. Stattdessen nutzte man Baustoffe, um offene und freundliche Bauwerke zu schaffen, die viel Licht hineinließen. Einer der prägendsten Baustile Emdens dieser Zeit ist der Backsteinexpressionismus (vgl. Station 2). Ein besonders schönes Beispiel ist der 1928 vollendete Brückenkiosk, der zusammen mit der Boltenbrücke und den Straßenlaternen ein beeindruckendes Ensemble bildet. Besonders an dem Kiosk sind beim genauen Hinschauen ganz unterschiedliche Formen der Gestaltung zu erkennen. Entdecke die Backsteinvielfalt des Brückenkiosks.
Zickzackfries [1] und einfacher Fries [2] aus
flachen Ziegelsteinen am Architrav des Baus.
Sie sind aus Ziegelsteinen hergestellt, die daher
deutlich heller sind, als die Klinker [3] des
Unterbaus.



Salomonische Säulen aus Klinkern am
Brückenkiosk.
Ansicht des Brückenkiosks, auch als
Chinesentempel bezeichnet. Das spitze Dach gibt
dem Bau eine ganz eigene Note.



Die kunstvoll geschmiedeten Geländer des
Tempels sind typisch für die 1920er Jahre-
Architektur.
Die Laternen an der Brücke sind Unikate und
gehören zum Gesamt-Ensemble dazu.