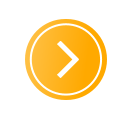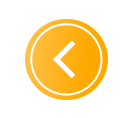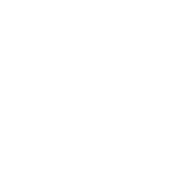Ensemble Bentinksweg
Die kleinen Wohnhäuser im Bentinksweg stehen in großem Kontrast zu den expressionistischen Bauten der 1920er Jahre. Ab dem späten 19. Jahrhundert und vor allem in den Jahren nach 1900 entwickelte sich in Europa eine starke nationalistisch geprägte Stimmung. Diese trat auch in der Architektur zunehmend in Erscheinung. Gerade in Deutschland hatte man das Gefühl, keinen nationalen Baustil zu haben. Die Baustile des Mittelalters (Romanik, Gotik und Renaissance) und die daraus entstandenen Stile des Historismus wurden maßgeblich durch die Entwicklungen in Frankreich und Italien geprägt und kamen im mittelalterlichen und neuzeitlichen Deutschland in kaum veränderter Art zum Einsatz. Viele Bürger der damaligen Zeit befürchteten, dass durch eine „globale“ Architektur die regionalen und lokalen Bauweisen verloren gingen. Schlussendlich würden dann ja alle Städte gleich aussehen. Außerdem hatten die Bürger mitbekommen, wie massiv sich die Städte im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung verändert hatten, vor allem durch den Abbruch mittelalterlicher Bauten und dem damit verbundenen Neubau größerer (Verwaltungs-) Bauten im Stil des Historismus. Daraus entstand in Deutschland unter anderem die sogenannte Reformarchitektur, zu der eine ganze Reihe unterschiedlicher Strömungen zählen, die sich zum Teil auch regional unterscheiden. Die große Gemeinsamkeit der Reformarchitektur war die Abkehr von den Baustilen des Historismus. Das Bauensemble im Bentinksweg stammt aus der Zeit um 1905 und gehört zur sogenannten Heimatschutzarchitektur, eine Strömung der Reformarchitektur. Der Heimatschutzstil entstand um 1900 und wandte sich gegen die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung der Städte und Vorstädte. Man versuchte mit dem Baustil die traditionelle und regionaltypische Bauweise zu erhalten und diese dennoch weiterzuentwickeln. Der Heimatschutzstil betont handwerkliche Qualität, lokale Materialien und historische Bauformen, um die Identität und Kultur einer Region zu schützen und zu fördern. Das Wort "Heimatschutz" steht für den Schutz der Heimat, was sich sowohl auf die gebaute Umgebung als auch auf die landschaftliche und kulturelle Identität bezieht. Die Wohnhäuser wurden aus roten Ziegelsteinen – nicht Klinkern – errichtet (vgl. Station 2), was seit Jahrhunderten der typische Baustein der Region war. Die Fenster und der Dachgiebel sind reich verziert. Die Nutzung von Holz erinnert entfernt an alpenländische Architektur und ist historisch betrachtet nicht typisch für die gewachsene ostfriesische Architektur, in der nur selten Holz als Zierelement zum Einsatz kam. Nimm dir einen Moment Zeit und erkunde die Architektur der Wohnhäuser in der Straße.
Dieses Haus hat wieder einen reich verzierten
Giebel mit Holzschmuck, auch wenn es sich um
vergleichsweise einfache Formen handelt.
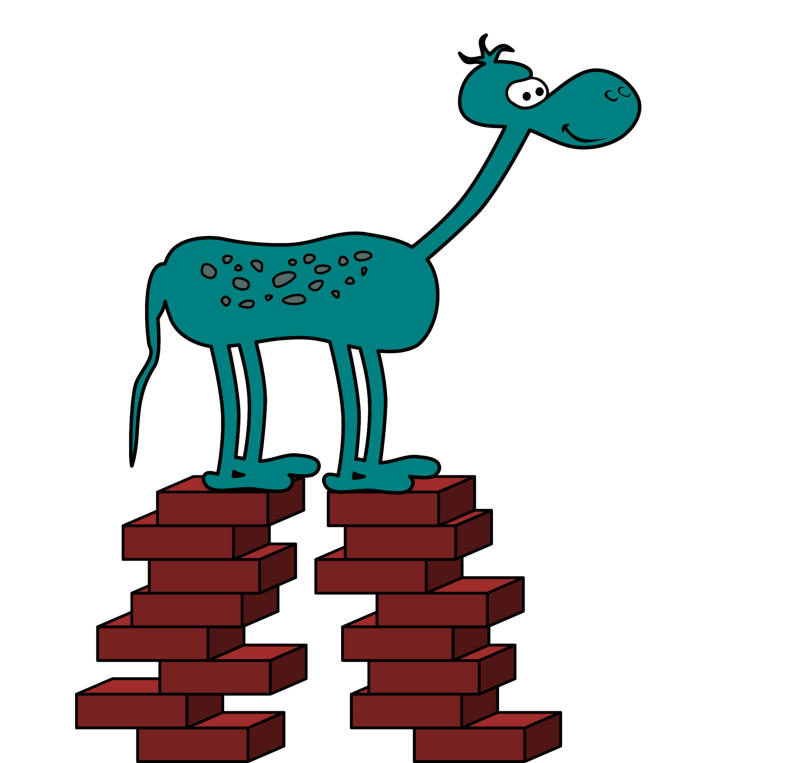





Bei diesem Haus ist auch die Lampe über der Tür
im Originalstand der 1920er Jahre erhalten.
Dieses Haus ist besonders reich verziert, vor
allem der hölzerne Giebelschmuck ist typisch für
die Heimatschutzarchitektur, auch wenn Holz
historisch betrachtet kein so bedeutender
Baustoff im ostfriesischen Raum war. Über den
Fenstern sind prächtige Schmuckelemente zu
sehen.
Typisch für die Heimatschutzarchitektur ist der
ganz einfach gestaltete Giebel aus Holz [1], das
umlaufende Gesims [2] und die Verzierungen an
den Fenstern [3].
Kleines Wohnhaus mit einfachen Verzierungen
rund um Tür und Fenster.