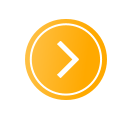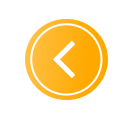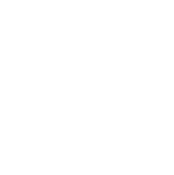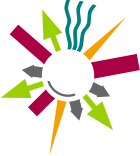Vorfrühling der
Quantenphysik
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachtete man die Physik vielerorts als abgeschlossen, nachdem Maxwell seine Theorie des Elektromagnetismus erfolgreich formuliert hatte und damit die Mechanik sowie Thermodynamik als verstanden galten. Diese Ansicht wurde jedoch durch neue Entwicklungen ab 1900 in der Physik erschüttert. Die Beobachtungen konnten mit den Ideen der Physik des 19. Jahrhunderts auf einmal nicht mehr erklärt werden. So entdeckte der britische Physiker J.J. Thomson (*1856, †1940) etwa zeitgleich mit dem unter anderem in Göttingen arbeitenden deutschen Physiker und Seismologen Emil Wiechert (*1861, †1928) im Jahr 1897 das Elektron als subatomares Teilchen (subatomare Teilchen = alles, was kleiner ist als ein Atom, es aufbaut oder beeinflusst). Ein weiteres, damals noch ungelöstes Problem war die Stabilität des Atoms, da klassische Theorien voraussagten, dass Elektronen durch Strahlung ständig Energie verlieren und in den Kern stürzen müssten. Der Durchbruch kam im Jahr 1900, als Max Planck (*1858, †1947) die Quantenhypothese einführte. Er postulierte, dass Energie nur in diskreten Quanten absorbiert oder emittiert wird, was die Grundlage der Quantenphysik bildete. Albert Einstein (*1879, †1955) erweiterte diese Idee im Jahr 1905 auf den photoelektrischen Effekt. Im Jahr 1913 löste Niels Bohr (*1885, †1962) das Problem der Atomstabilität, indem er vorschlug, dass die Elektronen auf festen Bahnen um den Atomkern kreisen und nur beim Übergang zwischen diesen Bahnen Strahlung emittieren. Diese Quantisierung der Bahnen und die damit verbundene Erklärung der Spektrallinien des Wasserstoffatoms führten zur weiten Akzeptanz von Bohrs Theorie. Trotz ihrer Erfolge stießen Bohrs Annahmen auf Schwierigkeiten bei der Anwendung auf komplexere Atome wie Helium. Zu Beginn der 1920er Jahre wurde zunehmend klar, dass die Theorie weiterentwickelt werden musste. Das Bohrsche Korrespondenzprinzip legte die Grundlage für die spätere Entwicklung der Quantenphysik, indem es annahm, dass bei hohen Quantenzahlen die Quantenphysik in die klassische Mechanik übergeht.
James Clerk Maxwell (*1831, †1879) war ein
schottischer Physiker, der zu den größten
Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts zählt. Er
ist vor allem für seine Arbeiten zum
Elektromagnetismus bekannt, insbesondere für
die Formulierung der Maxwell-Gleichungen. Sie
beschreiben das Verhalten von elektrischen und
magnetischen Feldern und ihre Wechselwirkung
mit Materie. Maxwell zeigte, dass Licht eine Form
elektromagnetischer Wellen ist, was die
Grundlage für die moderne Optik und
Elektrodynamik bildete.
Der photoelektrische Effekt zeigt, dass Licht
nicht nur als Welle, sondern auch als Teilchen
(Photonen) mit bestimmten (diskreten) Energien
auftritt. Diese Theorie lieferte den
entscheidenden Beweis für die Quantennatur des
Lichts und trug wesentlich zur Entwicklung der
Quantenphysik bei.
Das Korrespondenzprinzip von Niels Bohr
besagt, dass quantenmechanische Theorien in
der Grenze großer Quantenzahlen in die
klassische Physik übergehen müssen. Das
bedeutet, dass sich Quantenphysik und
klassische Mechanik nicht widersprechen. Die
Quantenphysik umfasst auch die klassische
Physik als Spezialfall für große Systeme. Dieses
Prinzip spielte eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung der Quantentheorie.
Diskrete Quanten? Ein Elektron im Atom kann
nicht jede beliebige Energie haben. Es „springt“
(wie bei einer Treppe) nur zwischen festen
Energiewerten – diesen diskreten Quanten.
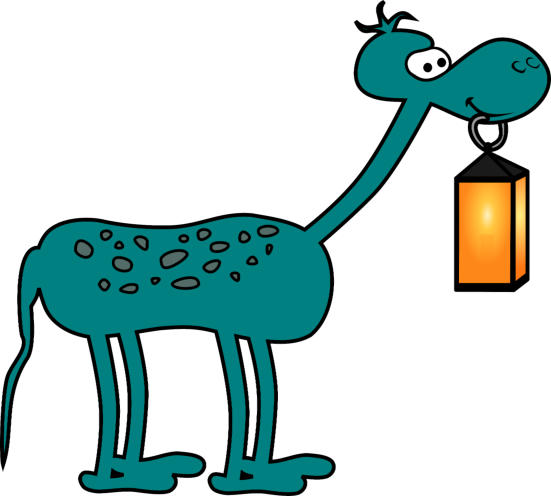

Das Michaelis-Haus wurde 1737 als London-
Schänke errichtet und war ursprünglich ein
Gasthaus für Gäste der Universität.
Ab 1842 bis ins frühe 20. Jahrhundert befanden
sich in dem Michaelis-Haus das Physikalische
Institut und das Mathematische Institut.