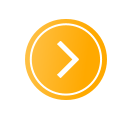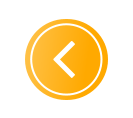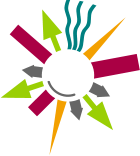Mönckebergstraße
Die Mönckebergstraße verbindet den Hauptbahnhof mit dem Rathaus und zählt zu den exklusivsten Einkaufsmeilen Deutschlands. Geschichtlich betrachtet ist die Straße jedoch nicht wirklich alt. Wie auch das Kontorhausviertel (vgl. Station 6) entstand die Straße erst um 1900, nach der schweren Choleraepidemie. Bis dahin war dieser Altstadtbereich durch zahlreiche, enge Gassen und sehr dichte Bebauung gekennzeichnet. Heute wird die Mönckebergstraße von Kontorhäusern aus der Jahrhundertwende (um 1900) geprägt. Mit dem Abriss der hier stehenden Gebäude wurde nicht nur ein völlig neuer Straßengrundriss geschaffen, sondern auch mit den Planungen zum Bau einer U-Bahn begonnen, die 1912 in Betrieb genommen wurde. Die unter der Mönckebergstraße verlaufende U-Bahnlinie gehörte zu den ersten Strecken des Hamburger U-Bahn-Netzes. Die Spitaler Straße ist eine alte, mittelalterliche Straße, die erst mit dem Bau der Mönckebergstraße ihren heutigen Verlauf erhielt. An der Einmündung der Spitaler Straße auf die Mönckebergstraße entstand ein kleiner Platz. Mitten auf dem Platz steht die ehemalige „Volkslesehalle“ (Bücherhalle). Sie wurde 1914/1915 errichtet und war damals Teil der städtischen Bibliothek. Ab der Jahrhundertwende (um 1900) entwickelte sich in Hamburg auf Betreiben der Patriotischen Gesellschaft (vgl. Station 4) die Idee von Bibliotheken und Lesehallen, wo Menschen an das Lesen herangeführt wurden. Damals war das Lesen bei weitem noch nicht so verbreitet, wie heute. Links und rechts der Spitaler Straße stehen heute zwei große Kontorhäuser der Gründerzeit, links die Seeburg und rechts der Barkhof.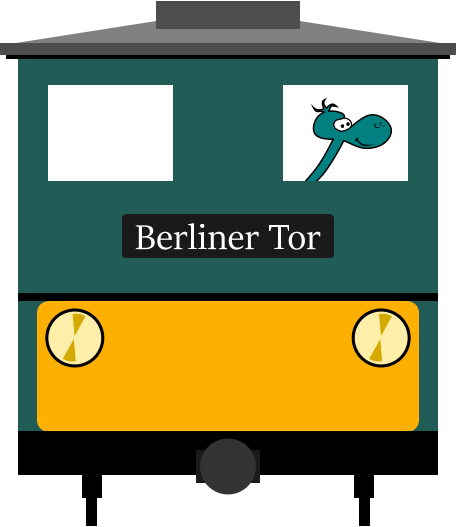

Spitalerstraße um 1884

Hamburg ist bekannt für ein paar Gerichte und
Spezialitäten. Lugo muss als
Leckermäulchen bei jedem Hamburg-Besuch
ein (oder mehrere) Franzbrötchen
verdrücken.Ein Franzbrötchen ist ein typisches
Hamburger Feingebäck. Seine
Entstehungsgeschichte ist bis heute nicht
abschließend geklärt.
Manch einer glaubt, das Franzbrötchen stammt
aus der Hamburger Franzosenzeit.
Es soll damals ein längliches, französisches Brot
gegeben haben, woraus sich das
Gebäck entwickelt hat.
Eine zweite Theorie gibt ein stimmigeres Bild
ab: Das Gebäck soll in Hamburg
Altona vom franzschen bzw. französischen
Bäcker entwickelt worden sein. In einem
Flugblatt von 1825 kündigt eine
Innenstadtbäckerei das Gebäck an:
„rundes und krauses Franzschbrod, sehr fett
und blätterich, sind nach dem Rezept vom
Franzschen Bäcker in Altona“.
Zitat: Ernst Stallmann: Chronik des Hamburger Bäckerhandwerks
1883-1983,
Bäckerinnung Hamburg, 1984

Lesehalle

Kontorhäuser