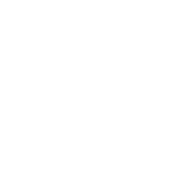Garten und Handwerk der
Landarbeiter
Die Landarbeiter bildeten zwar die Mehrheit der Bevölkerung, hatten jedoch politisch und gesellschaftlich im Ort kaum Einfluss. Viele der Landarbeiterfamilien lebten in großer Armut. Um etwas weniger auf das Einkommen angewiesen zu sein, waren viele der Landarbeiter – wie alle Bürger damals – zu großen Teilen auch Selbstversorger. Einen Markt oder ähnliches gab es in Loppersum nicht, ohne Kaufkraft hätte auch kaum jemand etwas kaufen können. In den kleinen Hausgärten wurden Obst, Gemüse und Kräuter angebaut. Außerdem hielten viele Familien kleinere Nutztiere wie Hühner, Schweine oder ein paar Ziegen, um Fleisch, Milch und Eier zu haben. Ein Pferd oder eine Kuh konnten sich die armen Landarbeiterfamilien nicht leisten. In der Natur sammelten sie darüber hinaus Früchte, Pilze und Kräuter. Sie hatten nicht die finanziellen Mittel, um Handwerker mit der Herstellung von Gerätschaften oder Alltagsgegenständen zu beauftragen. Aus diesem Grund stellten sie die benötigten Werkzeuge, Möbel und Gerätschaften selbst her. Die Landarbeiterinnen webten, nähten und strickten Kleidung sowie Haushaltsgegenstände wie Tischdecken und Vorhänge. Manche der hergestellten Textilien konnten sie verkaufen. Über diese Handwerkskunst und Gegenstände des täglichen Lebens ist bisher kaum etwas bekannt. Die Gerätschaften für die Bauern, kamen meist aus Emden. Nicht umsonst gab es seit dem 14. Jahrhundert einen regen Warenverkehr zwischen Emden und der Krummhörn. Das hier erhaltene Landarbeiterhaus ist wieder ein Doppelhaus. Anders als beim eben erwähnten Bummert (vgl. Station 5), sind die Wohneinheiten hier an der Längsseite miteinander verbunden und haben einen gemeinsamen Dachfirst. Die Steine des Gebäudes stammen wahrscheinlich von der mittelalterlichen Burg. Als diese im 19. Jahrhundert abgebrochen wurde (vgl. Station 4), nutzte man die Backsteine zum Bau des Landarbeiterhauses. Die Steine haben das sogenannte Klosterformat. Der Stallbereich ist direkt an die Landarbeiterhäuser angebaut. Diese Architektur erinnert entfernt an ein kleines Gulfhaus. Durch den Stall wurde ein Landarbeiterhaus quasi zu einem Bauernhof en Miniatur. Heute ist das doppelte Landarbeiterhaus saniert und im Inneren zu einem Haus verbunden. Dennoch sind die historischen Strukturen erhalten und lassen erahnen, wie es hier einst zuging.
Bis in das 19. Jahrhundert waren die
Dorfschiffer der Krummhörn für diese ländliche
Region von großer Bedeutung, denn sie
transportierten über ein dichtes Netz von
Kanälen Waren aller Art aus dem nahen Emden
in die ländliche Krummhörn. Sie brachten
anders herum auch Waren aus der Krummhörn
nach Emden, beispielsweise landwirtschaftliche
Produkte oder Torf als Brennmaterial.
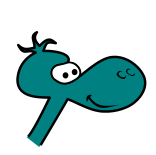
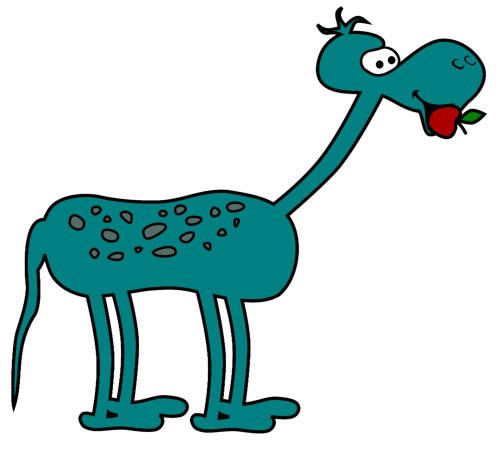
Das Klosterformat ist ein historisches
Ziegelformat, das im Mittelalter in Ostfriesland
für Kirchen, Klöster und repräsentative Bauten
verwendet wurde und so seinen Namen erhielt.
Mit einer Länge von etwa 28–30 cm, eine Breite
von 13–14 cm und einer Höhe von 8–9 cm waren
diese Ziegel größer als heutige Standardformate.