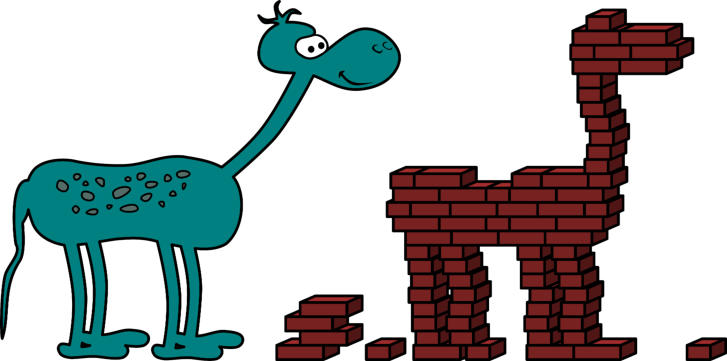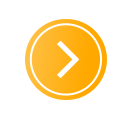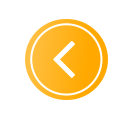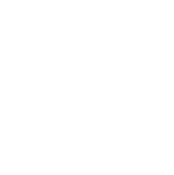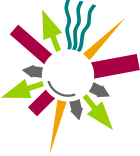St. Bartholomäus
Über die Anfänge der Besiedlung Dornums ist bis heute kaum etwas bekannt – die Burgen Dornums entstanden erst im späten 14. Jahrhundert. Um das Jahr 1000 begann der Deichbau in der Region. Es ist auch die Zeit, als die Region christianisiert wurde. Damals übernahm diese Aufgabe das Bremer Bistum - Dornum und damit die Kirche St. Bartholomäus gehörte zum Sendbezirk von Ochtersum. Im späten 13. Jahrhundert entstanden in der Region Dornums mehrere Backsteinkirchen, beispielsweise in Resterhafe oder Westeraccum – die Kirche in Nesse hingegen ist deutlich älteren Datums. Ob es in der Region zuvor hölzerne Kirchen als Vorgängerbauten gab ist unbekannt. Die Kirche St. Bartholomäus wurde wahrscheinlich zwischen 1270 und 1290 errichtet und ist vermutlich das mit Abstand älteste erhaltene Gebäude Dornums. Erst um 1420 wurde sie urkundlich erwähnt. Das Fundament der Kirche besteht aus Feldsteinen, der Ziegelbau wurde aus Ziegeln im Klosterformat errichtet. Das Klosterformat entstand im 12. Jahrhundert und hat seinen Namen wahrscheinlich von den damals zahlreich entstandenen Klosteranlagen und Kirchen. Über Jahrhunderte nutzte man das Klosterformat, auch wenn es keine einheitlichen Maße hatte. Die Maße variierten zwischen 28 cm × 15 cm × 9 cm und 30 cm × 14 cm × 10 cm. Um 1750 kam es zu einem umfassenden Umbau der Kirche. Damals wurde das Kirchenschiff verkürzt und das mittelalterliche Gewölbe abgebrochen. Der Glockenturm steht neben der Kirche in einem eigens errichteten Gebäude aus dem 13. Jahrhundert. Für die mittelalterlichen Kirchen Ostfrieslands ist es ganz typisch, dass der Kirchturm nicht direkt an die Kirche angebaut ist, sondern etwas abseits errichtet wurde. Man hatte Bedenken, dass bei Geläut der schweren Turmglocken der weiche Boden nachgeben würde und die Kirche Risse bekäme. Mit dem abseitsstehenden Kirchturm müsste man beim Absinken des Turmes im Zweifelsfall nur den Kirchturm wiederaufbauen und nicht gleich die ganze Kirche. Vor der Kirche steht eine etwa 200 Jahre alte Rotbuche, die von alten Grabkreuzen umstanden ist. Die Rotbuche hat ihren Namen von der rötlichen Holzfärbung und sollte nicht mit der Blutbuche – welche dunkelrote Blätter hat – verwechselt werden. Die Rotbuche ist die häufigste heimische Baumart in Deutschland und kann eine Höhe von bis zu 40 Metern erreichen.
Kirche St. Bartholomäus mit Glockenturm


Fassade aus Ziegelsteinen im Klosterformat
Unter der Buche sind - neben einiger Grabkreuze
- auch alte Klöppel von Kirchenglocken zu finden.

Rotbuche um Spätherbst